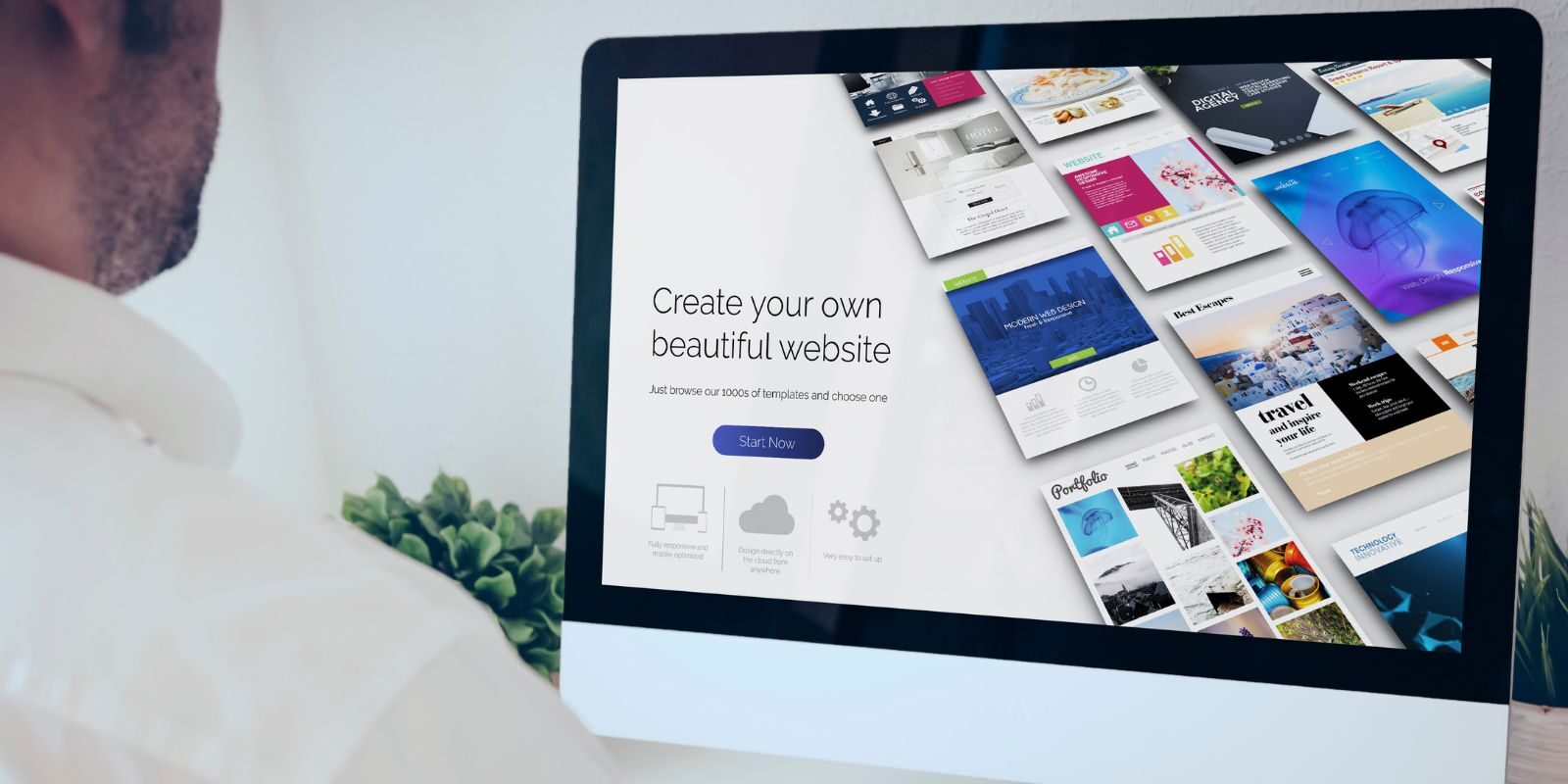Ob es um die Pflege einer öffentlichen Website, eines Unternehmensblogs oder um die Verwaltung interner Inhalte und Dokumente geht – überall dort, wo digitale Informationen strukturiert erstellt, bearbeitet und bereitgestellt werden, kommen Content-Management-Systeme (CMS) zum Einsatz. Sie ermöglichen es, Inhalte zentral zu verwalten, effizient zu organisieren und bei Bedarf zu veröffentlichen. CMS bilden damit nicht nur die Grundlage vieler moderner Websites, sondern auch zahlreicher interner Plattformen in Unternehmen. Doch was genau ist ein CMS, wie funktioniert es, und worin unterscheiden sich die verschiedenen Systeme?
Wie funktioniert ein CMS?
Ein klassisches CMS bietet eine grafische Benutzeroberfläche, über die Benutzer Inhalte erstellen und verwalten können, ohne selbst Code schreiben zu müssen. Diese Inhalte können nach Veröffentlichung im Frontend* der Website angezeigt werden und auch für API-Schnittstellen* zur Verfügung stehen. Zwei wichtige Komponenten greifen dabei ineinander:
- Content-Management-Application (CMA): Die CMA ist die Benutzeroberfläche für Redakteure, in der Inhalte wie Texte oder Bilder eingegeben und verwaltet werden. Diese Inhalte werden dann von der CMA in strukturierter Form in einer Datenbank abgelegt.
- Content-Delivery-Application (CDA): Die CDA arbeitet im Hintergrund. Sie sorgt dafür, dass die Inhalte, die in die CMA eingegeben wurden, ordnungsgemäß im Frontend angezeigt werden. Wenn ein Besucher eine Seite mit einer bestimmten URL* aufruft, ermittelt die CDA den zugehörigen Datensatz aus der Datenbank und wandelt ihn in eine darstellbare Website um.
Durch diese Trennung von Inhaltspflege und technischer Auslieferung wird die Verwaltung einer Website deutlich effizienter und benutzerfreundlicher. Änderungen am Erscheinungsbild – etwa Schriftarten oder Farbschemata – werden zentral über Designvorlagen gesteuert, was die Pflege auch großer Websites vereinfacht.
Welche Arten von CMS gibt es?
CMS lassen sich anhand ihrer Betriebsart und Lizenzform unterteilen:
Selbst gehostete vs. Cloudbasierte CMS (via SaaS):
Während selbst gehostete Systeme auf dem eigenen Webserver installiert werden und volle Kontrolle über Daten, Code und Erweiterungen bieten, laufen cloudbasierte Lösungen über die Infrastruktur des Anbieters – inklusive Wartung, Updates und Hosting*. Letztere werden häufig via SaaS* (“Software as a Service”) bereitgestellt. Cloudbasierte CMS sind besonders komfortabel für Einsteiger, während selbst gehostete CMS mehr Flexibilität und Anpassbarkeit ermöglichen.
Open-source vs. Proprietäre CMS:
Open-Source-CMS sind kostenlos verfügbar und können frei angepasst und erweitert werden. Sie profitieren von aktiven Entwicklergemeinschaften und einer meist großen Auswahl an Erweiterungen. Im Gegensatz dazu werden proprietäre CMS von Unternehmen entwickelt und lizenziert. Sie bieten meist professionellen Support, sind jedoch kostenpflichtig und hinsichtlich Anpassung und Erweiterbarkeit stärker eingeschränkt.
Was sind die Vorteile eines CMS? Und gibt es auch Nachteile?
Content-Management-Systeme bieten zahlreiche Vorteile und stellen für Unternehmen, Agenturen und Einzelpersonen eine attraktive Lösung dar. Richtig eingesetzt, ermöglichen sie konsistente Markenauftritte, beschleunigte Arbeitsabläufe und eine langfristig skalierbare Webpräsenz. Gleichzeitig können sie auch gewisse Nachteile mit sich bringen, die Nutzer sorgfältig abwägen sollten. Die wichtigsten Vor- und Nachteile lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Einfache Bedienbarkeit und geringe Einstiegshürde
- Zentrale Inhaltsverwaltung
- Einheitliches Erscheinungsbild über alle Seiten hinweg
- Zeit – und Kosteneffizienz bei der Website-Pflege
- Mehrbenutzerfähigkeit durch Rollen- und Rechtesystem
- Hohe Flexibilität bei individuellem Ausbau
- Erweiterbarkeit durch Plugins* und Module
- Oft Integration von SEO-Tools und Medienverwaltung
- Oft Community und Support
- Initialer Aufwand bei Einführung
- Regelmäßiger Wartungsaufwand durch Updates
- Leistungseinbußen bei schlechter Optimierung
- Abhängigkeit von Drittanbietern
- Kosten für Hosting, Premium-Plugins oder externe Entwickler
- Sicherheitsrisiken bei mangelnder Pflege
Was sind die gängigsten CMS?
Der Markt für Content-Management-Systeme ist vielfältig und die Wahl des passenden Systems kann eine Herausforderung sein. Ein Überblick über die in Deutschland gängigsten CMS und ihre zentralen Merkmale erleichtert die Orientierung.
WordPress
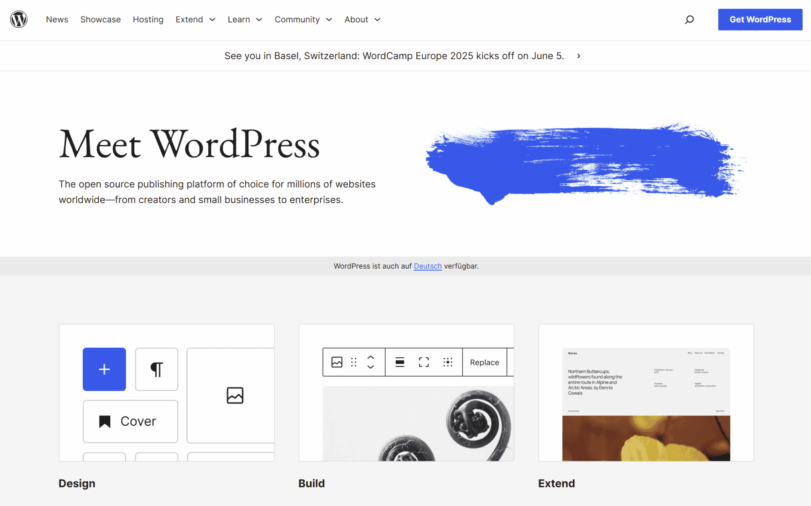
Ursprünglich 2003 für Blogger entwickelt, ist WordPress heute das weltweit am häufigsten genutzte, freie CMS. Es wird von 43,4 % aller Websites verwendet und hat einen Marktanteil von 61,3 % unter den CMS (Quelle: W3techs). WordPress ist Open Source, kann unter wordpress.org heruntergeladen werden. In dieser Version wird es in der Regel selbst gehostet, was maximale Kontrolle über Funktionen, Design und Daten ermöglicht. Alternativ steht mit wordpress.com auch eine gehostete Plattform zur Verfügung. Besonders beliebt ist WordPress für Blogs, Unternehmensseiten und Onlineshops – letzteres oft mit der Erweiterung WooCommerce.
WordPress überzeugt durch seine große Community, eine riesige Auswahl an Designvorlagen und Plugins, seine hohe Benutzerfreundlichkeit und große Gestaltungsfreiheit. Es eignet sich sowohl für Einsteiger als auch Profis. Zu beachten ist jedoch der regelmäßige Wartungsaufwand: Updates für das System, Themes (Designvorlagen) und Plugins sind notwendig, um Sicherheitslücken zu vermeiden – denn durch seine Verbreitung ist WordPress ein häufiges Ziel von Hackerangriffen. Weiterführende Informationen zu WordPress gibt es in unserem ausführlichen Wissensportal-Beitrag.
Joomla!
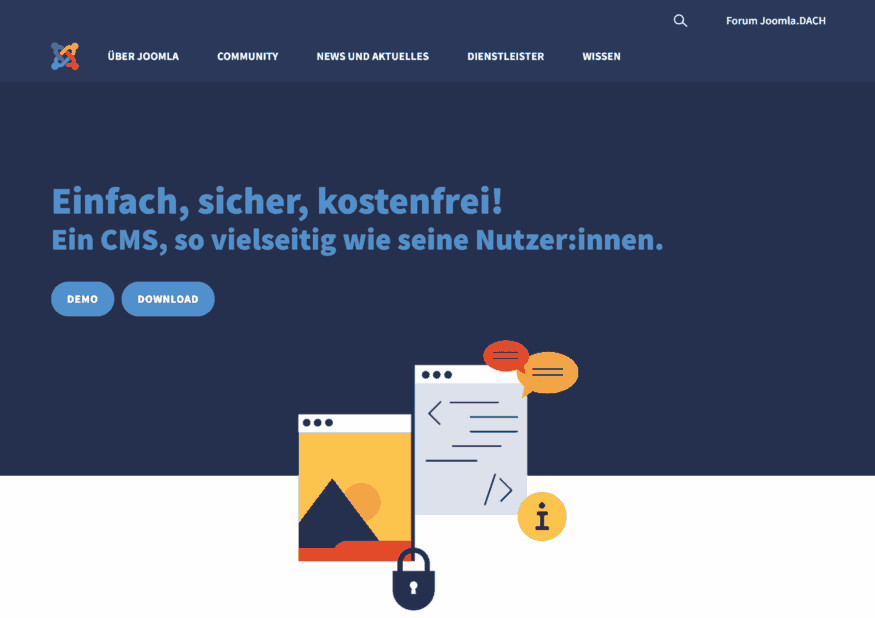
Joomla ist ein flexibles und erweiterbares Open Source CMS, das sich besonders für mittlere bis größere Websites eignet. Es verfügt über ein ausgefeiltes Rechtemanagement, das differenzierte Benutzerrollen bietet. Dank eines modularen Aufbaus können Inhalte flexibel strukturiert und organisiert werden. Joomla bietet zahlreiche Erweiterungen, jedoch ist das Ökosystem kleiner als bei WordPress.
Die Bedienung ist im Vergleich zu anderen Systemen etwas komplexer und erfordert eine gewisse Einarbeitung, bietet dafür aber mehr Kontrolle über Benutzerrollen. Joomla eignet sich besonders für Projekte, bei denen eine fein granulierte Zugriffssteuerung erforderlich ist. Auch für mehrsprachige Websites ist Joomla gut gerüstet, denn Mehrsprachigkeit ist bereits im Core integriert.
Drupal
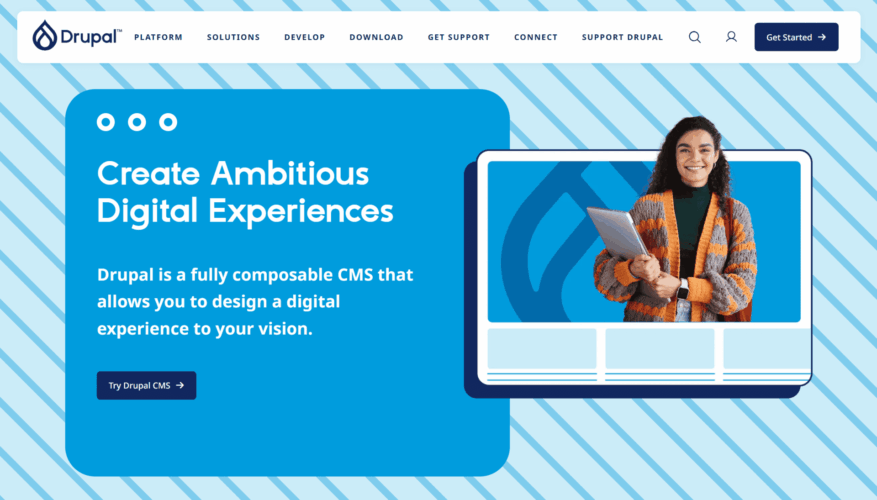
Drupal ist ein leistungsstarkes und sicheres CMS, das vor allem bei komplexen, datenintensiven und individuellen Webprojekten zum Einsatz kommt. Es ist Open Source und wird in der Regel selbst gehostet. Typische Einsatzbereiche sind Behörden, NGOs, Bildungseinrichtungen und großen Onlineplattformen. Drupal ist von Haus auf Mehrsprachigkeit ausgerichtet und eignet sich gut für Websites mit vielen redaktionellen Rollen.
Aufgrund seiner Komplexität richtet es sich in erster Linie an erfahrene Entwickler oder Agenturen – der Einstieg für Laien ist vergleichsweise anspruchsvoll. In professionellen Händen ist Drupal jedoch äußerst leistungsfähig und zukunftssicher.
TYPO3
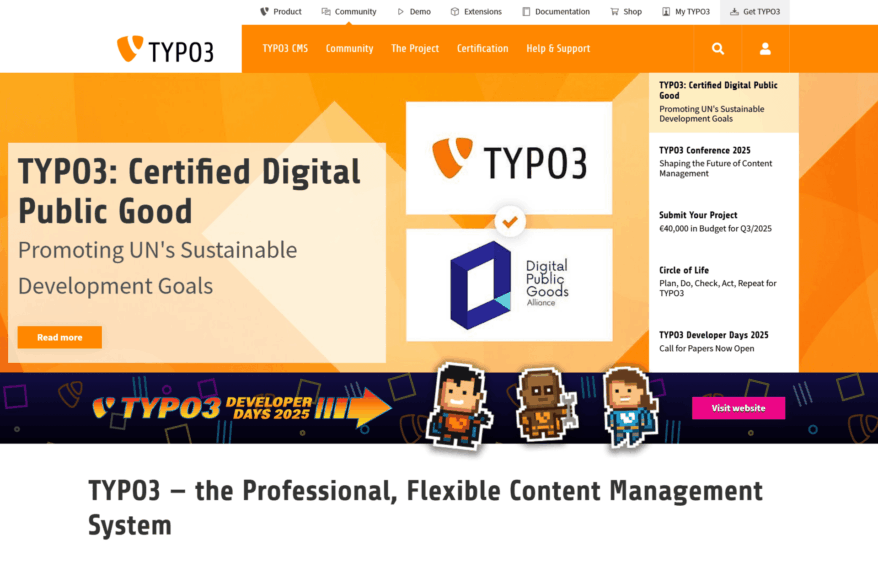
TYPO3 zählt zu den etablierten CMS-Lösungen für anspruchsvolle Webprojekte – insbesondere im DACH-Raum. Es eignet sich für mehrsprachige und skalierbare Websites mit komplexen Anforderungen an Rechte- und Inhaltsverwaltung. Das System bringt viele Funktionen bereits im Kern mit – darunter ein fein abgestuftes Rechtemanagement und integrierte Mehrsprachigkeit. Typische Einsatzbereiche sind große Unternehmensportale, Hochschulen, Verbände und öffentliche Institutionen.
TYPO3 ist Open Source und wird in der Regel selbst gehostet. Die Bedienung des Systems ist für Redakteure nach entsprechender Schulung einfach. Die Einrichtung und technische Anpassung erfordern jedoch Erfahrung, da TYPO3 auf maximale Flexibilität ausgelegt ist. TYPO3 bietet zahlreiche Erweiterungen, jedoch ist das Ökosystem kleiner und stärker kuratiert als bei WordPress.
Contao
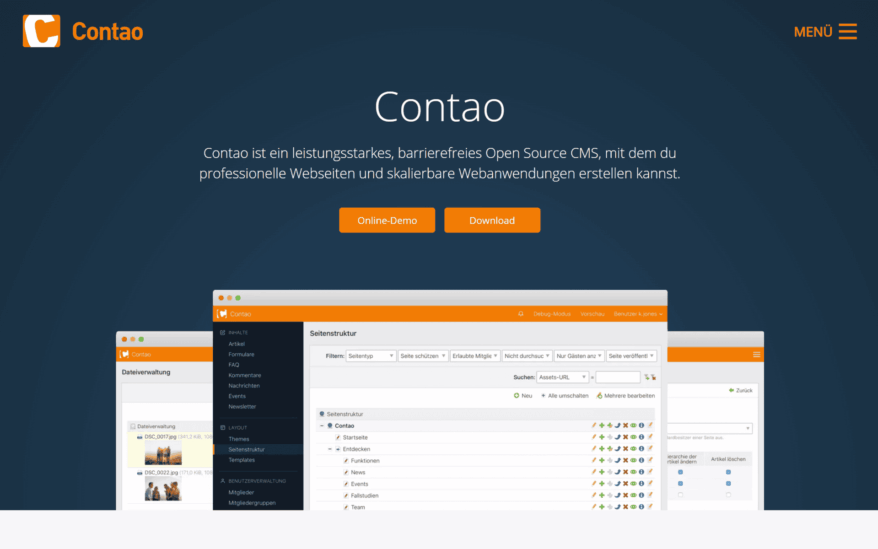
Contao ist ein modernes Open-Source-CMS, das sich besonders im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Es eignet sich ideal für kleine bis mittlere Projekte, bei denen hoher Wert auf benutzerfreundliche Bedienung gelegt wird.
Das System überzeugt mit integrierten Standardfunktionen für Barrierefreiheit, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Mehrsprachigkeit. Auch die flexible Benutzer- und Rechteverwaltung macht Contao zu einer soliden Wahl für redaktionell gepflegte Websites. Im Vergleich zu größeren Systemen wie WordPress ist die Auswahl an Erweiterungen und Designvorlagen zwar überschaubarer, dafür punktet Contao mit klarer Codebasis.
Welches CMS ist das Richtige für mich?
Ein CMS ist nicht grundsätzlich besser oder schlechter als ein anderes – vielmehr hängt die Wahl des passenden Systems von den individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen des Projekts ab. Je nach Projektziel, Umfang und technischer Expertise eignen sich manche Systeme besser als andere. Bei der Auswahl eines CMS spielen unter anderem folgende Kriterien eine Rolle:
- Struktur und interne Abläufe des Unternehmens: Ein CMS sollte sich in die bestehenden Arbeitsprozesse integrieren lassen. Besonders bei mehreren Redakteuren oder Abteilungen sind klare Rollen- und Workflow-Funktionen wichtig.
- Bereits bestehende IT-Systeme und Integrationen: Schnittstellen zu CRM, ERP oder Onlineshops können entscheidend sein. Je besser das CMS integrierbar ist, desto effizienter läuft der gesamte digitale Betrieb.
- Zielsetzung des Webprojekts und genutzte Kommunikationskanäle: Ob Unternehmenswebsite, Blog, Intranet oder Onlineshop, die Zielsetzung beeinflusst die Auswahl maßgeblich. Auch die Bespielung mehrerer Kanäle wie Website, App oder Newsletter sollte bei der Wahl berücksichtigt werden.
- Erwartungen und Bedürfnisse der Zielgruppen: Das CMS sollte Inhalte so aufbereiten können, wie sie die Zielgruppe erwartet – etwa barrierefrei, mobilfreundlich und visuell ansprechend.
- Anzahl und Verwaltung mehrerer Websites: Wenn mehrere Websites zentral verwaltet werden sollen, ist ein CMS mit Multi-Site-Funktionalität besonders wichtig. Damit lassen sich nicht nur Inhalte, sondern auch Benutzerrechte, Designvorlagen, Sprachversionen und technische Einstellungen über mehrere Auftritte hinweg effizient steuern – ohne redundante Pflege oder doppelte Installationen.
- Mehrsprachigkeit und internationale Ausrichtung: Wer internationale Märkte bedient, braucht ein CMS mit solider Unterstützung für mehrsprachige Inhalte und ggf. Lokalisierungs-Workflows.
- Art und Umfang der zu verwaltenden Inhalte: Einfache Websites brauchen andere Funktionen als datenintensive Plattformen mit komplexen Inhaltsstrukturen oder Nutzerinteraktionen, wie etwa Formularanfragen, Bewertungen oder Kaufabschlüsse.
- Verfügbares Budget für Entwicklung, Wartung und Erweiterungen: Neben der Erstinstallation sind auch laufende Kosten für Hosting, Plugins, Lizenzen oder externe Dienstleister zu berücksichtigen.
Ein sorgfältiger Abgleich dieser Faktoren mit den Möglichkeiten der jeweiligen CMS-Optionen schafft die Grundlage für eine fundierte Entscheidung.
Fazit: Digitale Inhalte klug verwalten und strategisch nutzen
Content-Management-Systeme leisten weit mehr, als nur Inhalte auf Websites darzustellen. Sie helfen dabei, Informationen zentral zu strukturieren, effizient zu verwalten und für unterschiedliche Zielgruppen und Kanäle bereitzustellen. Ob Newsbereich, mehrsprachige Website oder Onlineshop, CMS bilden das technische Fundament moderner Webprojekte.
*Glossar: Begriffe kurz erklärt
Frontend: Der sichtbare Teil einer Website, den Besucher im Browser sehen. Umfasst Texte, Bilder, Navigation, Farben und Layout. Die Inhalte, die im Frontend angezeigt werden, werden im Administrationsbereich des CMS erstellt oder bearbeitet.
API-Schnittstelle: API steht für „Application Programming Interface“. Eine API-Schnittstelle ermöglicht es Programmen, automatisch auf bestimmte Inhalte oder Funktionen eines Systems zuzugreifen. So können Daten strukturiert an andere Anwendungen (wie Apps, Suchmaschinen oder externe Websites) übergeben werden, ohne dass Nutzeroberflächen benötigt werden. Inhalte, die über die API verfügbar sind, können z. B. auch außerhalb des Frontends genutzt oder weiterverarbeitet werden.
URL: Die Abkürzung für „Uniform Resource Locator“. Eine URL ist die eindeutige Webadresse, unter der eine Webseite im Internet aufgerufen wird – zum Beispiel https://www.ianeo.de/. Sie zeigt dem Browser, wo sich eine bestimmte Ressource (z. B. eine HTML-Seite oder ein Bild) befindet und wie sie abgerufen werden soll (z. B. über https).
SaaS: Die Abkürzung für „Software as a Service“. Dabei handelt es sich um ein Bereitstellungsmodell, bei dem Software über das Internet genutzt wird – ohne eigene Installation oder Server. Die Anwendung läuft auf der Infrastruktur des Anbieters, der sich um Wartung, Hosting und Updates kümmert. Viele cloudbasierte CMS werden via SaaS angeboten, sodass Nutzer direkt über den Browser darauf zugreifen können.
Plugin: Plugins dienen der Erweiterung des CMS um zusätzliche Funktionen – zum Beispiel Kontaktformulare, SEO-Tools, Galerien oder Sicherheitsfunktionen. Plugins erweitern den Funktionsumfang des CMS, ohne dass der Core-Code verändert werden muss.
Hosting: Hosting bezeichnet die Bereitstellung von Speicherplatz und technischen Ressourcen auf einem Server, damit eine Website über das Internet erreichbar ist. Der Hosting-Anbieter stellt die notwendige Infrastruktur wie Webserver, Datenbanken und Domains zur Verfügung. Ohne Hosting kann eine Website nicht online betrieben werden.